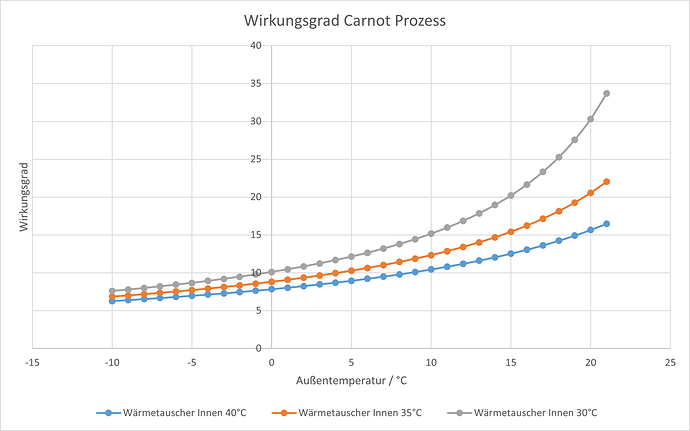Eben das bezweifle ich. Wenn ich sonst keine Parameter ändere, sinkt die Temperatur des Wärmetauschers, während das AG immer noch dieselbe Wärmemenge produziert. Für den Moment des Hochlaufens des Lüfters wird temporär mehr Wärme in den Raum abgegeben. Wenn aber nicht mehr produziert wird, kann nicht mehr Wärme in den Raum gelangen. Das Beispiel mit der Suppe hinkt insoweit, als dass die Suppe auf dem Teller steht und immer kälter wird. Trotzdem bekomme ich durch Pusten auch nicht mehr Wärme aus der Suppe in den Raum als wenn ich sie stehen lasse.
Auch hier dasselbe wie bei der Suppe. Wenn ich nicht gleichzeitig die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers im Heizkörper erhöhe, wird nur das Wasser im Heizkreis kälter und bei gleicher Energiezufuhr von Energieerzeuger bleibt die Wärmezufuhr in den Raum im besten Fall gleich, weil die Wärmeenergie, die ich dem Wasser im Heizkörper entnehmen kann, endlich ist. Der Faktor Zeit ist hier entscheidend. Puste ich zu lang, ist die Suppe kalt. Kalte Suppe mag ich aber nicht ![]()
Wenn ich mehr Wärme wegnehmen kann, heißt das, sie war vorher da und ist auf unerklärliche Art und Weise verschwunden. Wenn ich die Suppe einfach stehen lasse, ist sie nach 30 Minuten kalt. Puste ich, ist sie nach 20 Minuten kalt. Wenn ich die Suppe jetzt nicht nachwärme, kann ich pusten so viel ich will. Ich bekomme keine Wärme mehr aus der Suppe.
[quote data-userid="8074" data-postid="180969"]Der DLE passt seine Leistung an, je mehr Wasser, um so höher die Leistung, damit die Temperatur konstant bleibt. Bis zu dem Punkt, wo seine Maximalleistung erreicht ist. Steigert man dann noch mehr den Volumenstrom des Wassers, sinkt die Temperatur.
Genau das habe ich geschrieben. Und genau das ist der Punkt. Verändere ich im Gesamtsystem LLWP nur den Parameter Luftvolumenstrom am IG, bekomme ich nicht mehr Wärme in den Raum. Ob das ganze durch die Erhöhung des Luftvolumenstroms effizienter wird, ist bisher nur eine Arbeitshypothese, für die ein Nachweis fehlt.
Ob und in wie weit die Erhöhung der Lüfterdrehzahl am IG Auswirkungen auf die sonstigen Anlagenparameter hat, bleibt zu prüfen.
Da ist wieder unser Problem. Mein Ziel beim Durchlauferhitzer ist es, das Wasser auf eine bestimmte Temperatur zu bekommen. Ich sage, ab einer bestimmten Durchflussmenge bekomme ich das Wasser nicht mehr auf Zieltemperatur.
Du sagst, die komplette elektrische Energie wird mit nahezu 100% Effizienz in Form von Wärme ans Wasser abgegeben.
Beide haben wir Recht, kommen aber nicht zusammen, weil wir unterschiedliche Seiten derselben Medaille betrachten. Du betrachtest Kopf, ich Adler. Wir sprechen über Augen und sind uns einig, dann sage ich "Federn" und Du denkst: "Was will er?".
Um zurück zum eigentlichen Punkt der Diskussion zu kommen:
Es fehlen uns Messdaten, die belegen könnten, dass eine höhere Lüfterstufe am IG im Nutzungsfenster einer (Multi-)Split-Klimaanlage beim Heizen effizienter ist als eine niedrigere Lüfterstufe. Wichtig wären hier die Einlass- und Auslasstemperatur am IG sowie elektrische Leistungsaufnahme über einen längere Zeitraum, so dass sicher gestellt ist, dass sich die Raumtemperatur nicht verändert.